Partnering for transformation
„Die Welt ist im Wandel; Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe geworden. Die nationale, internationale Politik hat eine klare Marschrichtung eingeschlagen. Wir, die Salzgitter AG, stellen uns der Herausforderung der CO2-Reduktion, wir begreifen sie als Chance und stellen sie ins Zentrum unseres Handelns. Das braucht Mut, Mut hin zum Wandel zu nachhaltigen Produktionsprozessen, nachhaltigen Lösungen und Produkten – gemeinsam mit unseren Kunden.“
Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzender
Maßnahmen zur Dekarbonisierung
In unserer Strategie Salzgitter AG 2030 fest verankert

Beschleunigte
Dekarbonisierung
Ausweitung des
Schrottrecycling


Strom aus
nachhaltigen Quellen
Umstellung auf
SALCOS®-Route
Vollständige
Transformation

in Richtung Zukunft
Ein Beispiel aus der Praxis
Stahl als Grundstein der nachhaltigen Industrie von morgen
Szenario
Im Rahmen einer Studie der Salzgitter Mannesmann Forschung wurde ein Stahl-Lenkerkonzept als Alternative zu einem Schmiedelenker aus Aluminium konzipiert, ausgelegt und bewertet. Im Ergebnis stehen interessante Vorteile hinsichtlich Kosten und Umweltbilanz – bei vertretbarem Mehrgewicht.
Lebenszyklus
Durch das im Vergleich zu Aluminium etwas höhere Gewicht des Bauteils aus Stahl werden in der Nutzungsphase des Fahrzeugs mehr Emissionen emittiert. Wegen der geringeren Emissionen bei der Produktion und im Recycling ist die CO2-Bilanz des Stahlbauteils trotzdem oft besser.
Produktion
Stahl zeichnet sich durch besonders geringe CO2-Emissionen in der Produktionsphase aus. Und durch den Einsatz von SALCOS®-Stahl können die Emissionen in der Produktion noch weiter reduziert werden.
Lebenszyklusemissionen Stahl- vs. Aluminiumlenker
Fahrzeugemissionen
Fahrzeugemissionen pro 100 km: gCO2eq/kmEmissionen Stahlproduktion
CO2 Emissionen Produktion (Stahllenker): kgCO2eqEmissionen Aluminiumproduktion
CO2 Emissionen Produktion (Aluminiumlenker): kgCO2eq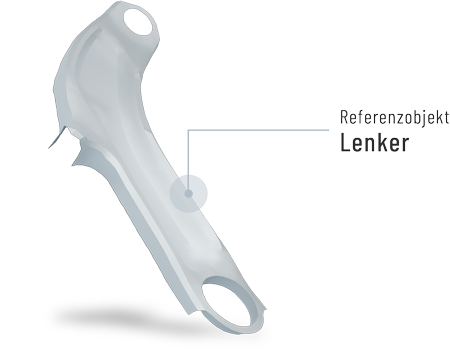
Dieses Tool wurde von unseren Experten für Lebenszyklusanalyse entwickelt. Die Daten stammen überwiegend aus der Datenbank der LCA for Experts-Software der Firma Sphera (https://sphera.com/life-cycle-assessment-lca-software/). Sie wurden sorgfältig recherchiert und ausgewählt. Trotzdem können Abweichungen resultieren, welche die Ökobilanz des Bauteils positiv oder negativ beeinflussen, so dass ein Konzept (Stahl/Aluminium) besser oder schlechter erscheint. Das Tool ist deshalb nicht für eine quantitative Bauteilbewertung vorgesehen, sondern soll lediglich die wichtigsten Einflüsse wie verwendeten Werkstoff und Antriebsart visualisieren und verdeutlichen. Für konkrete Nachfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Green Steel
Klassifizierungssystem Grüner Stahl
Die Stahlindustrie hat sich auf den Weg Richtung Klimaneutralität begeben. Neben den großen, aber technologisch machbaren Herausforderungen stellt sich die Frage, wie ein in der Herstellung teurerer „grüner“ Stahl seinen Weg in die Anwendung findet.
An dieser Stelle kommt das politische Instrument der „Grünen Leitmärkte“ ins Spiel. Leitmärkte für klimafreundliche Produkte sind ein zentraler Baustein zur Flankierung der Transformation und stellen eine wichtige Brücke dar, bis sich klimaneutrale Grundstoffe in voller Breite wirtschaftlich am Markt durchgesetzt haben.
Grüne Leitmärkte können sich in Europa allerdings nur dann entwickeln, wenn sie auf klaren Definitionen, standardisierten Zertifizierungsregeln und transparenten Einordnungen von Prozessen und Produkten basieren. Dazu bedarf es eines branchenweit abgestimmten Regelwerks, das international anschlussfähig ist.
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl hat mit ihren Mitgliedsunternehmen und dem BMWK im November 2023 in Berlin einen entsprechenden Entwurf als Grundlage eines freiwilligen Kennzeichnungssystems für CO2-reduzierten Stahl vorgestellt. Hier werden Stahlprodukte in Abhängigkeit ihrer Treibhausgasintensitäten und der Schrottquote klassifiziert. Den Kunden wird damit transparent und verlässlich eine Vergleichbarkeit von Herstellungsprozessen und Produkten ermöglicht. Mit dem dargestellten sogenannten „Sliding-Scale“ Ansatz trägt die Stahlbranche dem Umstand Rechnung, dass die Verfügbarkeit von Stahlschrott weltweit begrenzt ist und eine klimafreundlichere Einstufung nicht allein durch den vermehrten Einsatz von Stahlschrott erreicht werden soll.

Nachhaltige Zukunft
SALCOS®
Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Forschung haben wir mit SALCOS® die Grundlagen für eine nahezu CO2-freie Stahlproduktion geschaffen. Ziel des Programms ist die Vermeidung klimaschädlicher CO2-Emissionen bei der Herstellung von Primärstahl (CDA: Carbon Direct Avoidance). Statt mit fossiler Kokskohle im klassischen Hochofen wird das Eisenerz in einer Direktreduktionsanlage mit grünem Wasserstoff von Sauerstoff befreit, also reduziert. Der Wasserstoff hierfür wird per Wasserelektrolyse mit grünem Strom hergestellt. Das so gewonnene direkt reduzierte, feste Eisen (DRI) wird anschließend in einem Elektrolichtbogenofen aufgeschmolzen und herkömmlich weiterverarbeitet. Statt klimaschädlichem CO2 wird so lediglich harmloser Wasserdampf emittiert.
Im Ergebnis können wir 95 % unserer bisherigen CO2-Emissionen via herkömmliche Primärstahlerzeugung vermeiden.
des Stahls können bei der
Stahlherstellung recycelt werden -
ganz ohne Qualitätsverlust
Circularity
Recyclingstrategie
Schrott spielt bereits heute in der Stahlproduktion eine wesentliche Rolle. Die Recyclingquote von Stahl beträgt beinahe 100 %. Dabei wird Schrott heute entweder zur Erzeugung von Sekundärstahl verwendet oder aus prozesstechnischen Gründen mit einem festen Prozentsatz in der Primärstahlerzeugung eingesetzt. Die Umstellung auf Elektrolichtbogenöfen in der SALCOS®-Route ändert die Bedeutung von Schrott für unsere Primärstahlerzeugung. Zukünftig kann Schrott zusammen mit DRI im Elektrolichtbogenofen eingeschmolzen werden, um Stahlgüten mit variablem Schrottanteil herzustellen. So kann ein noch geringerer CO2-Fußabdruck realisiert werden. Wir streben ein Produktspektrum von 0 bis 60 % Schrottanteil an.



Ein weiterer Treiber
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ist ein Teil des „Fit for 55“-Pakets der Europäischen Union (EU). Ein primäres Ziel dieses Pakets ist die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in der EU bis 2030 um mindestens 55 %. Der Europäische Emissionshandel (EU-ETS) ist ein zentrales Klimaschutzinstrument der EU. Unternehmen müssen dabei sog. Emissionszertifikate für ihre emittierten Treibhausgase erwerben.
Nun können sich Unternehmen dafür entscheiden, die Kosten für die Emissionszertifikate zu vermeiden, indem sie ihre Produktion in Länder verlagern, die weniger ambitionierte Klimaschutzziele haben. Um die Anreize für die Produktionsverlagerung zu verkleinern, bekommen besonders emissionsintensive Unternehmen einen Teil der Emissionszertifikate bisher gratis zugeteilt. Die Gratiszuteilung wird planmäßig bis 2034 schrittweise auslaufen. Das CBAM-System soll nun den Wettbewerbsnachteilen im EU-ETS entgegenwirken, indem es die Kosten für Importgüter mit in der EU produzierten Gütern angleicht. Dazu soll für den Import bestimmter emissionsintensiver Produkte in die EU eine Ausgleichszahlung erhoben werden, die den CO2-Kostenunterschied zur Produktion innerhalb der EU berücksichtigt.


